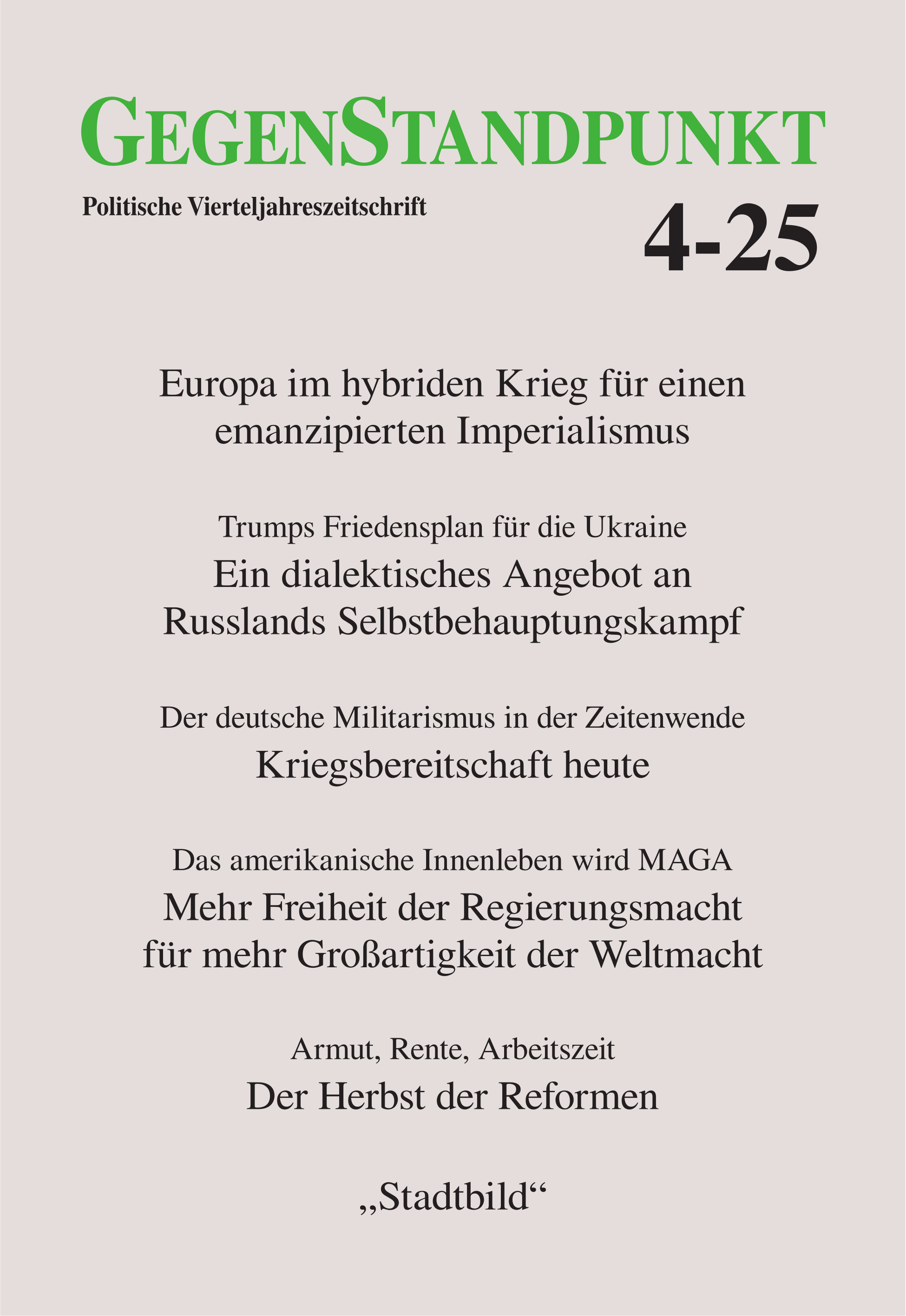Die Merz-Regierung sagt an: Kriegsbereitschaft muss sein. Dafür krempelt sie das Land um, will die Gesinnung der Bevölkerung auf Vordermann bringen und greift für das Militär auf Teile der Jugend zu. Politiker erklären auch, weswegen „wir alle“ Aufrüstung und Kriegsbereitschaft brauchen: Putin führt Krieg in der Ukraine und meint damit auch „uns“. Er lässt „uns“ keine Alternative, weil er „uns“ nicht in Frieden und Freiheit leben lassen will.
Da würden wir gerne schon mal wissen, was Putin dagegen haben sollte, dass die Menschen hierzulande ihrem Alltag nachgehen, arbeiten, zur Schule gehen, einkaufen und Kinos oder Discos besuchen. Aber geht es darum überhaupt, wenn die Regierung „unsere Sicherheit“ gleich an der russischen Westgrenze, in der ein paar tausend Kilometer entfernten Ukraine beginnen lässt und bedroht sieht?
Alles, was die deutsche Politik zur Abschreckung der russischen Militärmacht unternimmt, also dafür, dass sie überlegen Krieg gegen diese Macht führen kann – wofür Teile der eigenen Bevölkerung als Kampfmittel vorgesehen sind, die ihren Kopf hinzuhalten haben –, soll man ihr als Schutz des eigenen Lebens abkaufen.
„Uns allen“ wird damit die geistige Zumutung aufgemacht, sich die politische Herrschaft eines fremden Staates als eigenen, persönlichen Feind zu denken, und sich darüber unmittelbar mit der Kriegsplanung der deutschen Staatsgewalt zusammenzuschließen und für sie einspannen zu lassen.
Logisch ist das alles nicht. Darüber soll auf unserer Veranstaltung diskutiert werden. Und wir wollen uns der Frage widmen, wofür man sich eigentlich hergeben soll, wenn einem angesagt wird, „für Krieg bereit“ zu sein.
Lesetipp: Kriegsbereitschaft heute | GegenStandpunkt 4-25